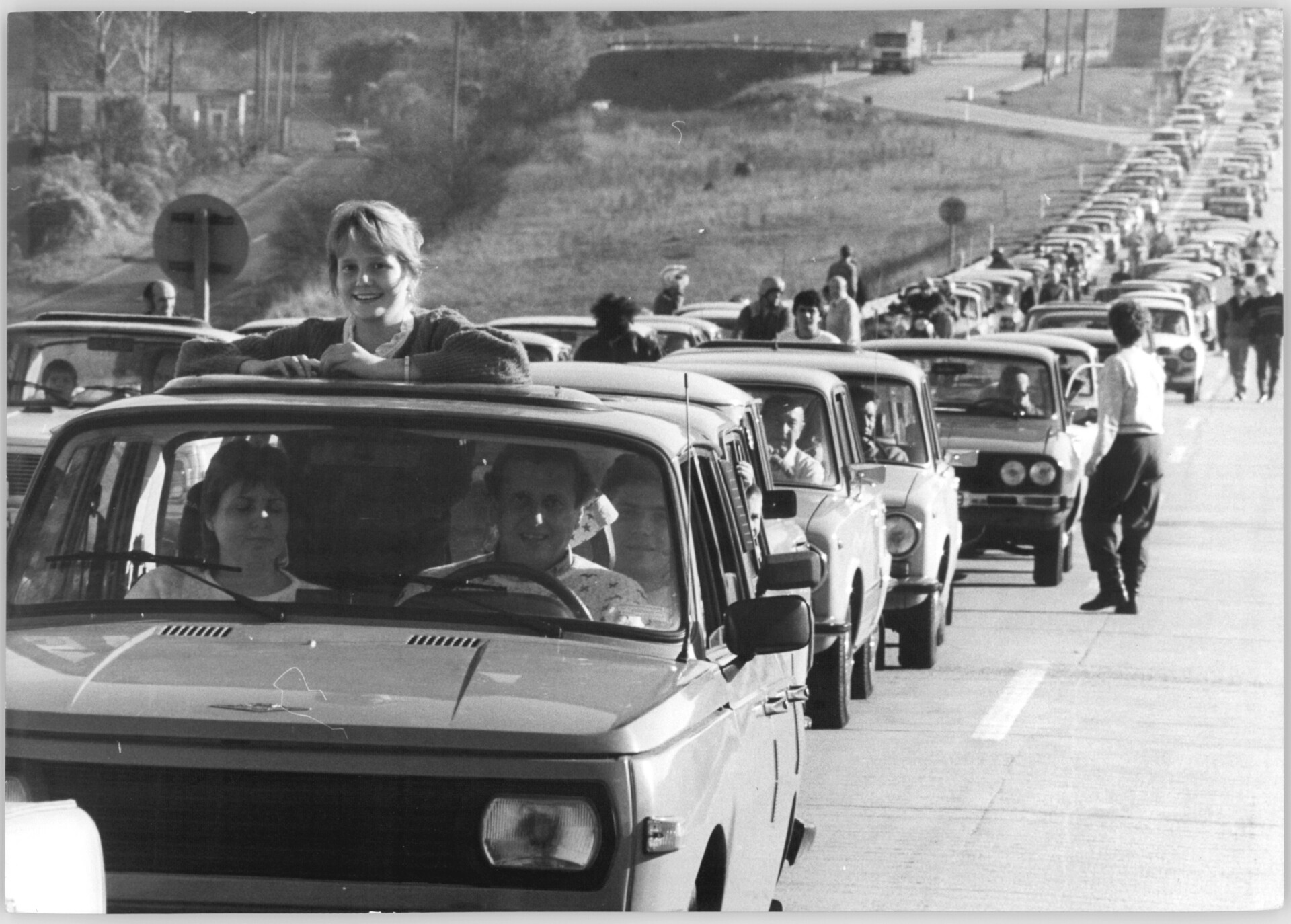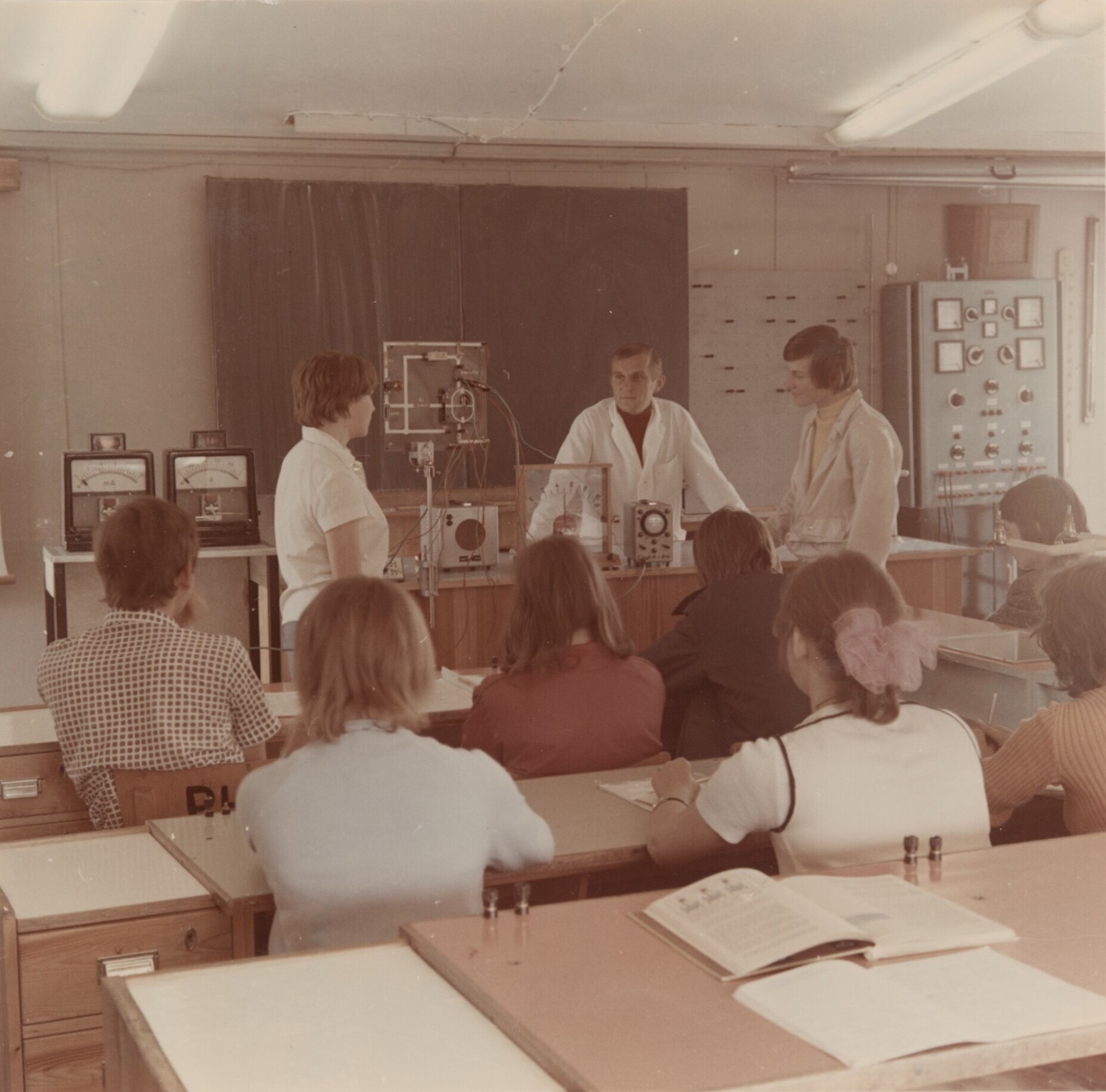Beschäftigungen, die bis 2012 von der Bundesanstalt bzw. Bundesagentur für Arbeit gefördert wurden, um Arbeitslosen eine Tätigkeit mit niedriger Entlohnung zu geben. Besonders in den 1990er-Jahren wurden ABM häufig als Instrument zur Behebung der großen Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern eingesetzt.
Glossar
Hier findet ihr kurze Erklärungen zu Begriffen aus den Texten und Quellen. Es handelt sich um eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn ihr euch weiter informieren möchtet, schaut gerne in weiteren Nachschlagewerken nach. Zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung oder dem Bundesarchiv.