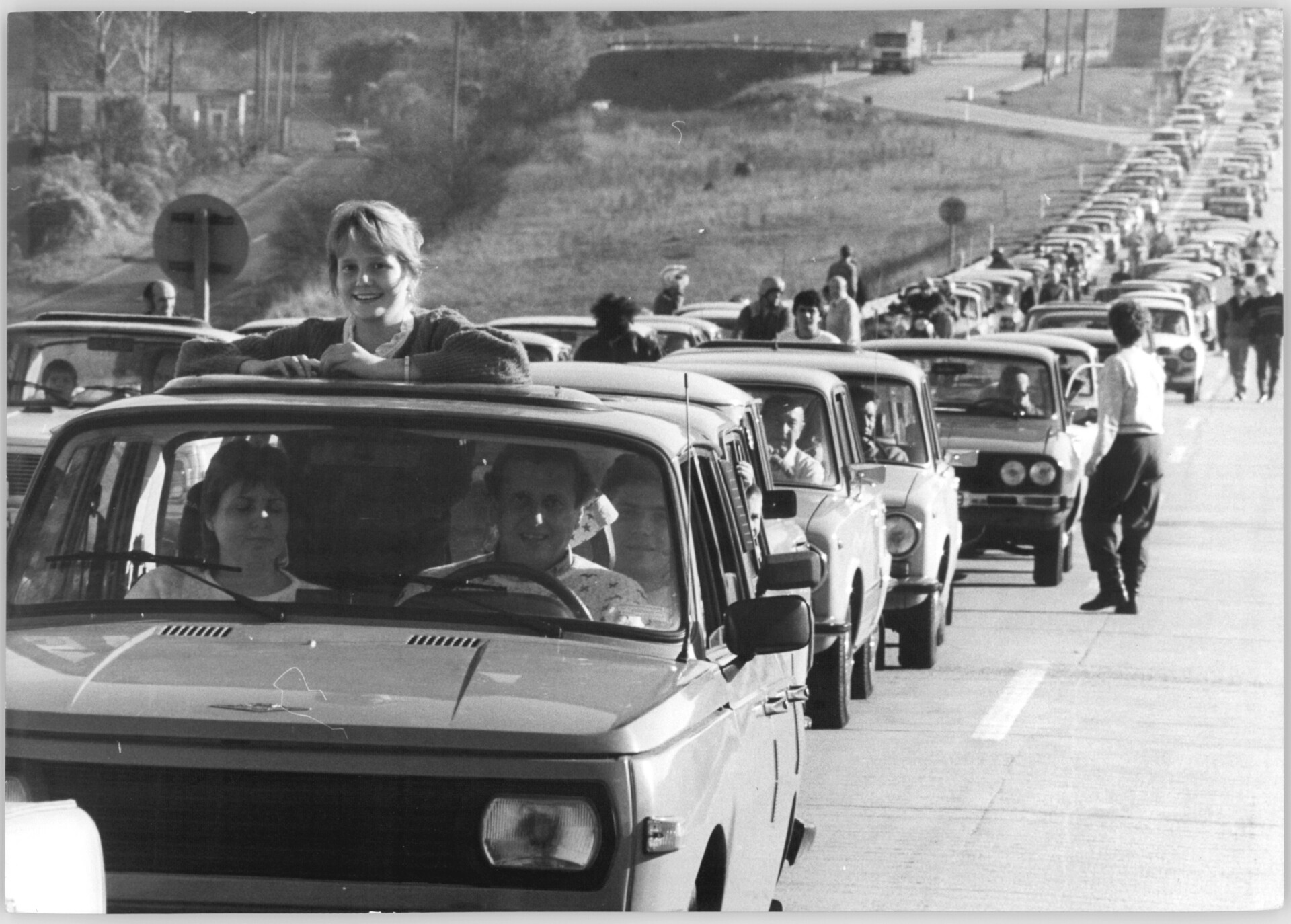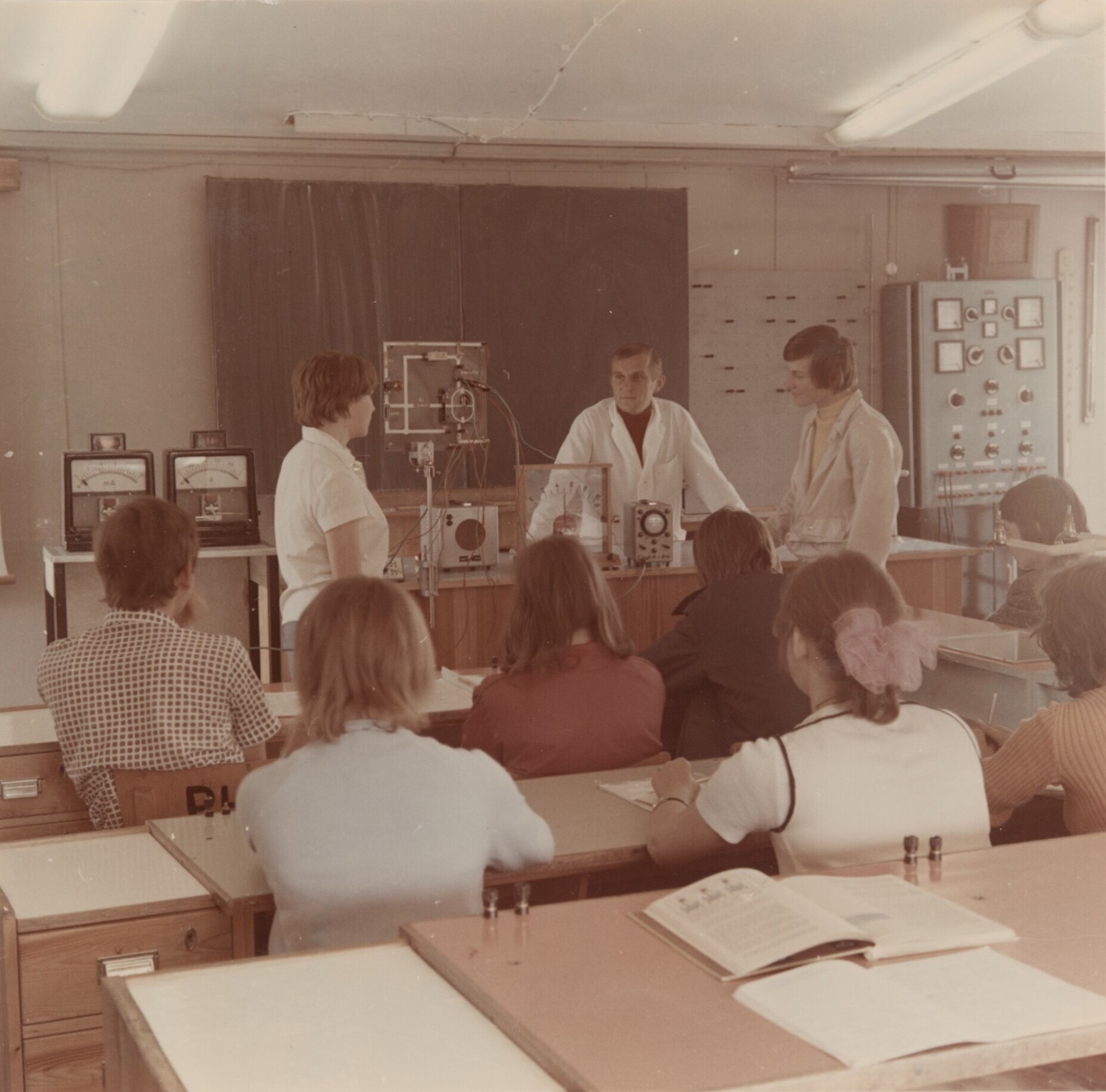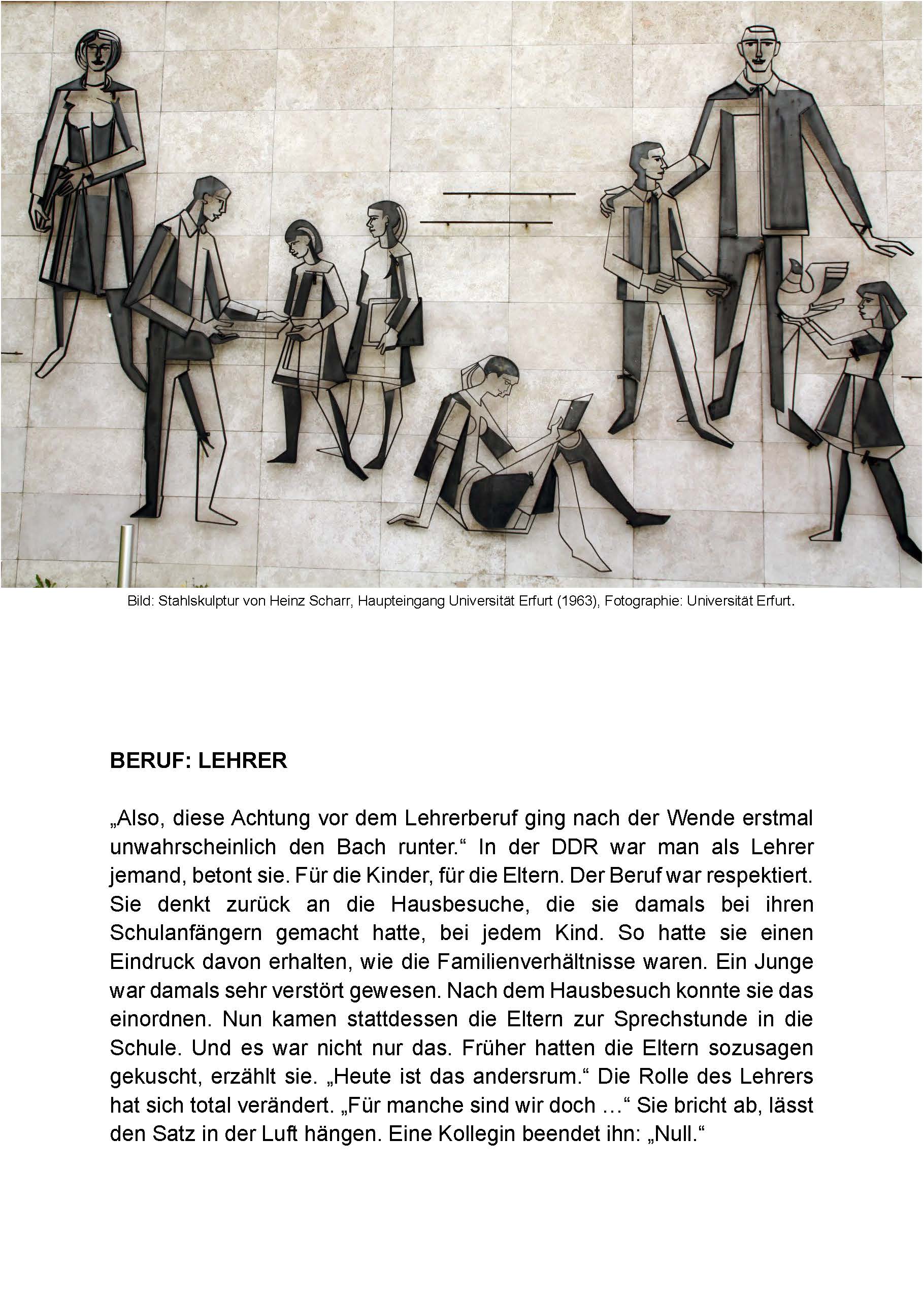Titel: Erinnerte Erfahrungen ehemaliger Heimatkundelehrerinnen der DDR an die Transformationszeit – Anekdote „Beruf: Lehrer“
Medienart: Erinnerungtext, Dokument
Autorinnen: Sandra Tänzer, Isabelle Lamperti, Isabell Tucholka
Jahr: 2024
Gesamtlänge: 1 Seite
Besitzende Institution: Universität Erfurt
Empfohlene Zitierweise: Sandra Tänzer, Isabelle Lamperti, Isabell Tucholka: Erinnerte Erfahrungen ehemaliger Heimatkundelehrerinnen der DDR an die Transformationszeit – Anekdote „Beruf: Lehrer“. Erfurt 2024. Abgerufen unter: https://dut-ausstellung.de/source/anekdote-beruf-lehrer/.