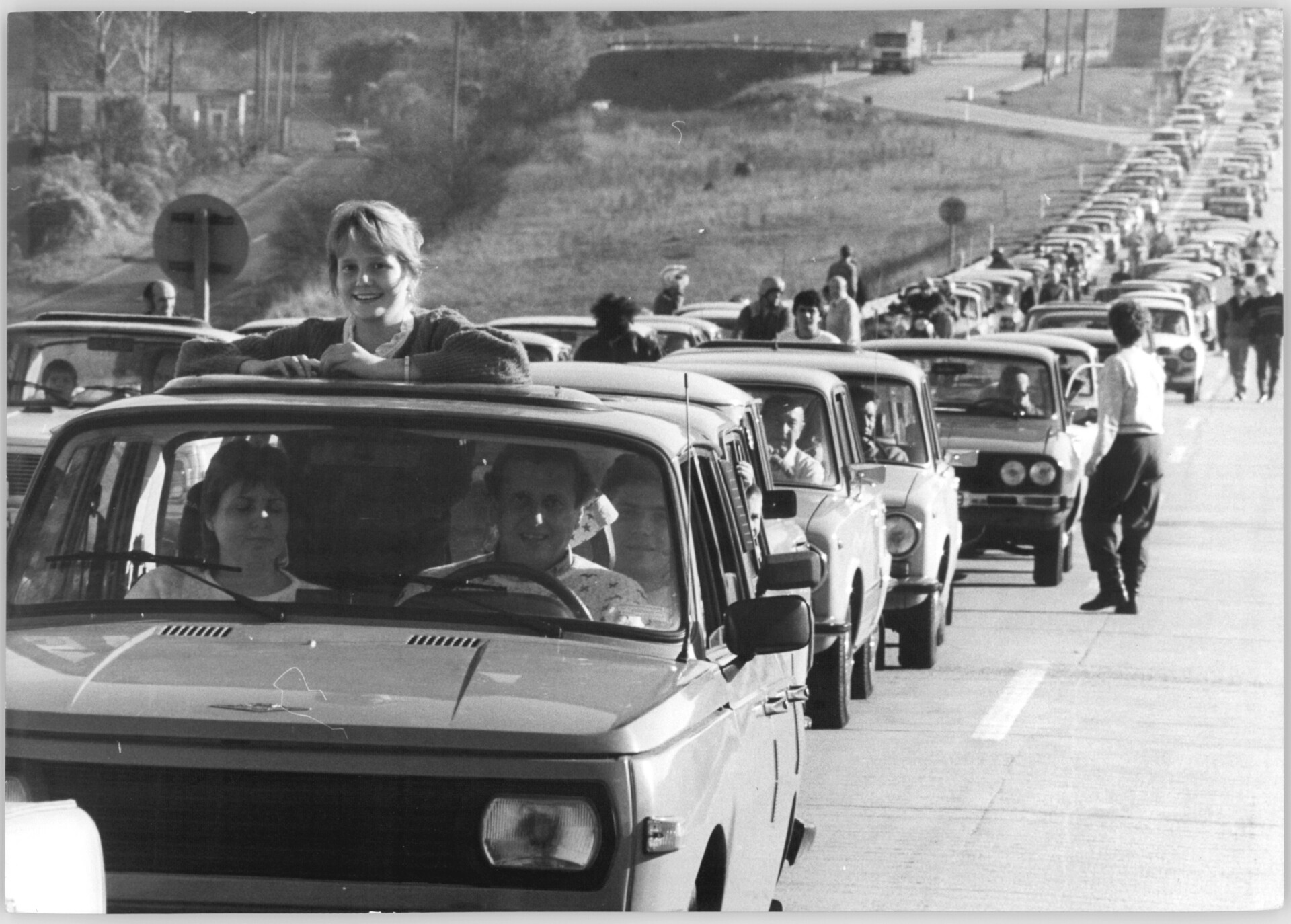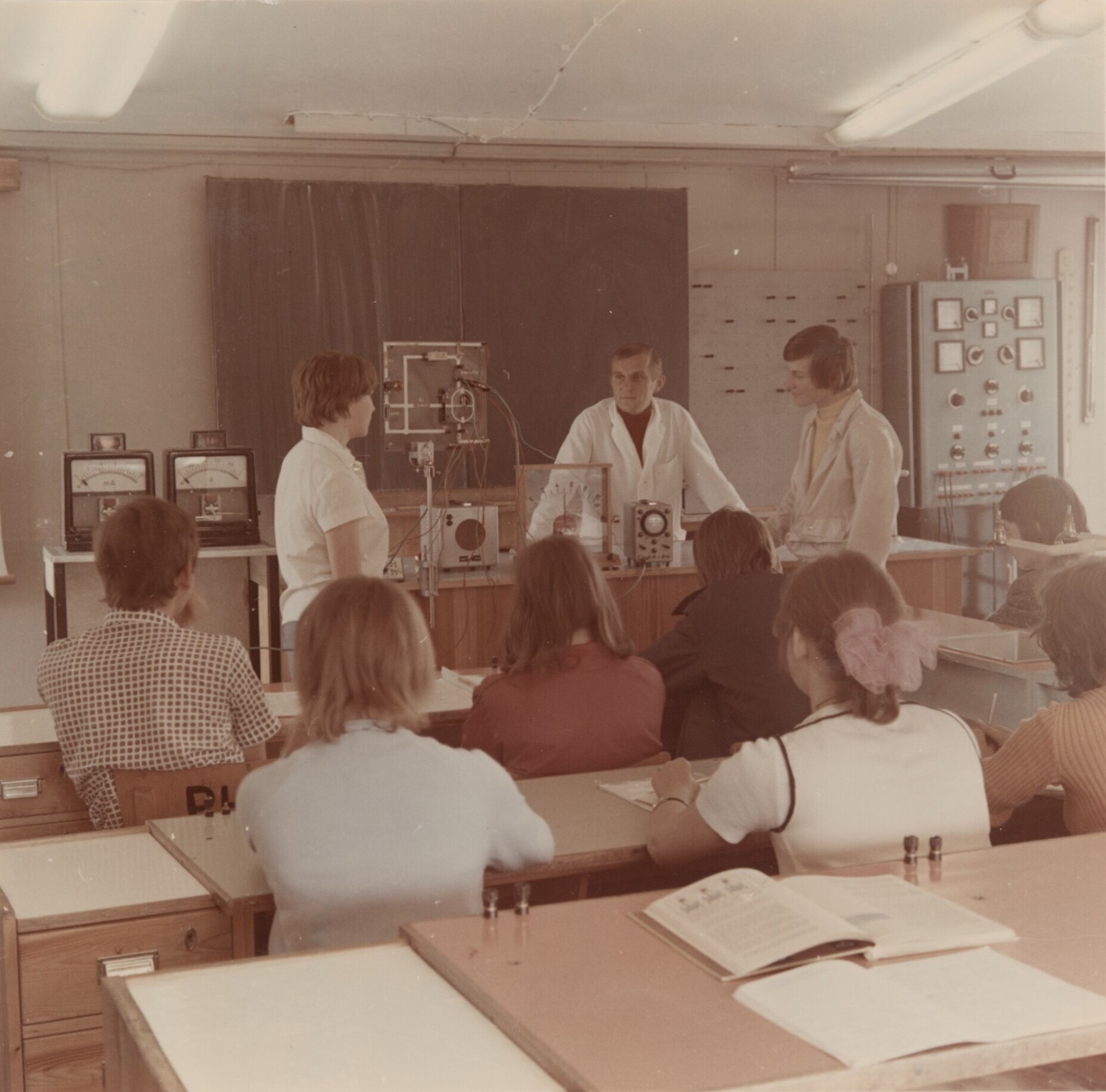Mittlerweile wird die Phase rechter Gewalt vor und vor allem nach 1989/90 intensiv untersucht. Im kulturellen Gedächtnis und öffentlichen Diskurs ist sie vor allem durch wenige Ortsnamen symbolisiert: Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen. Anders als diese Namen suggerieren, beschränkte sich die Gewalt aber nicht auf wenige Orte. Ein Charakteristikum rechter Gewalt in der Vereinigungsgesellschaft war gerade ihre räumliche wie zeitliche Entgrenzung, ihre Alltäglichkeit und Omnipräsenz, aber auch ihre Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit. Angriffe und Anschläge richteten sich gegen verschiedene Gruppen; die Gewalt war rassistisch, antisemitisch, antiziganistisch, antislawisch, sexistisch und homophob; sie traf aber auch politische Gegner:innen. Rechte Gewalt trat im Kontext von Mauerfall und Vereinigung auf, hatte in Ost- wie Westdeutschland eine Vorgeschichte. Sie prägte nicht nur die erste Hälfte der 1990er Jahre, sondern zieht sich bis in die Gegenwart.
Schon rund um den 3. Oktober 1990 hatte es deutschlandweit rechte Gewaltereignisse gegeben; die Vereinigung motivierte eine Welle nationalistischer Ressentiments gegen als nicht-deutsch stigmatisierte Personengruppen. Amadeu Antonio gehörte in Eberswalde zu der rund 100 Personen umfassenden Gruppe angolanischer Werktätiger, die in den späten 1980er Jahren für die Arbeit im nahegelegenen Fleischkombinat angeworben worden waren. Nach 1989/90 blieb kaum ein Dutzend von ihnen in der Stadt; vor allem diejenigen, die vor Ort Familien gegründet hatten. Amadeu Antonio wurde Ende November 1990 von einer Gruppe Skinheads durch Tritte lebensgefährlich verletzt. Am 6. Dezember erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er hinterließ seine schwangere deutsche Freundin.
In seinem ersten Dokumentarfilm über die Tötung Amadeu Antonios gelingt Thomas Balzer ein eindrückliches Porträt von der Stadtgesellschaft nach dem Verbrechen. Kameraführung und Schnitttechnik, Musik und O-Ton des Interviews stellen eine Atmosphäre alltäglicher Angst her. Das Gefühl einer untergründigen Bedrohung entsteht aus der Spannung von kindlichem Alltag und stets möglicher Gewalt. Die Drohungen – rechte Zeichen auf dem Boden, rechte Parolen an den Wänden – sind längst normalisiert. Dort, wo Kinder spielen, ist die selbst oft noch sehr junge rechte Szene präsent, auch wenn sie nicht anwesend und zu sehen ist. Dieser Eindruck eines Einbruchs der Gewalt in die Kindheit, die ja sorglos sein sollte, wird durch die Kameraführung verstärkt, die die Szenen fast durchgängig von unten aufnimmt.
Balzer kritisiert hier mit filmischen Mitteln die Atmosphäre der Angst in den ,Baseballschlägerjahren‘, in denen jugendliche Skinheadgruppen zum Alltag gehörten. Zugleich macht die Trennung von Tonspur und Bild im zweiten Teil der Filmsequenz deutlich, dass die nicht von Rassismus betroffenen deutschen Familien zwang- und sorglos ihre Freizeit verbringen, während für die Freundin von Amadeu Antonio mit ihrem kleinen Sohn – der immer wieder rassistisch diskriminiert wird (Rechte hatten sogar Hakenkreuze auf dem Kinderwagen hinterlassen) – der Alltag ein Spießrutenlauf ist. Im Interview berichtet Amadeu Antonios Freundin zudem, dass sie sich als Paar nicht gemeinsam auf die Straße trauten aus Angst, ihr oder ihm würde etwas geschehen. Sie waren zwar in der Liebesbeziehung vereint, aber wurden im Alltag durch die Angst vor Angriffen getrennt. Sie mussten sich aus Vorsicht stets allein im Stadtraum bewegen. Betroffene, die in dieser Zeit in Ostdeutschland lebten, berichten sehr häufig von solchen Vorsichtsmaßnahmen, die sie trafen, sobald sie sich in der Öffentlichkeit aufhielten.
Weitere Ausstellungskategorien
Träume & Albträume