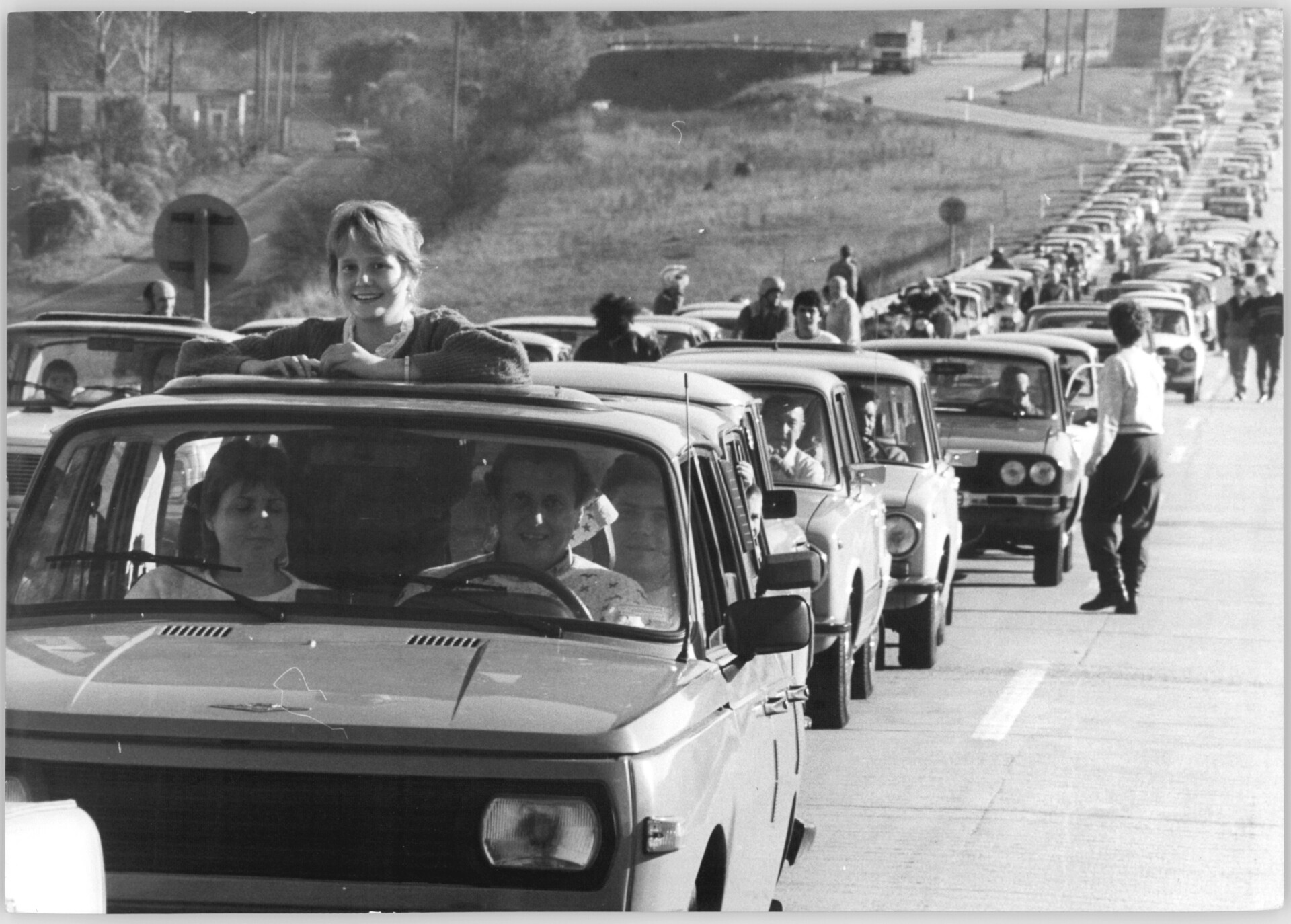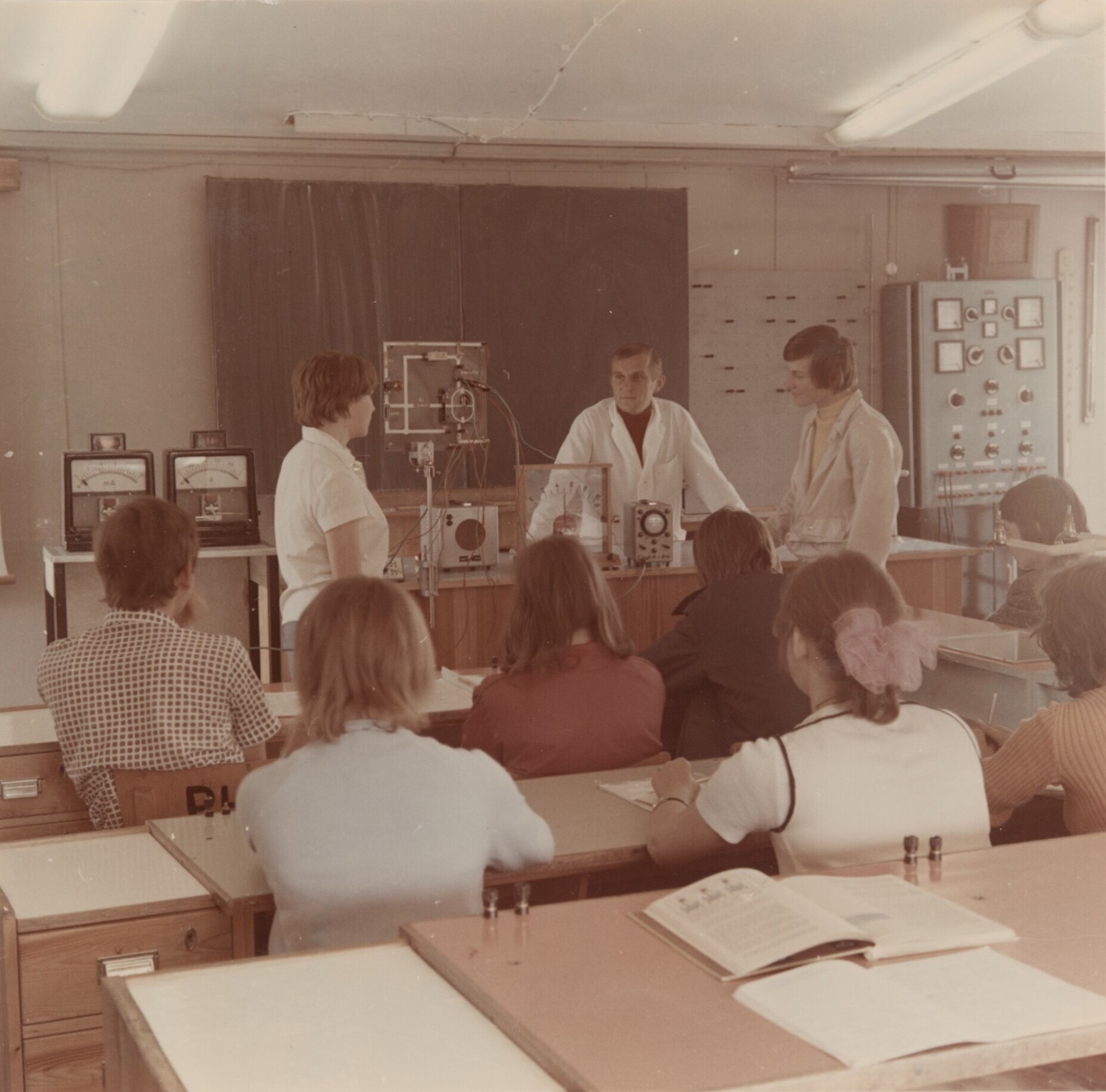Blicke durch beschlagene Scheiben, Spiegelungen, Reflexionen, Menschen im Vorbeigehen. Dunkle, dichte Rahmungen und Bilder, in denen sich der Raum aufzulösen scheint. Nichts ist gewiss in den Fotografien der Serie „Hinter Glas“. Die melancholische Stimmung in ihnen ist unmittelbar und lässt keinen Zweifel daran, dass ein Wohlgefühl hier nicht zu finden ist. Sind Menschen im Bild zu sehen, so hat man den Eindruck, sie sind sich selbst abhandengekommen.
Zeitgleich mit einigen Motiven der Serie, die Barbara Metselaar Berthold unter dem Titel „Hinter Glas“ zusammenfasste, entstanden zwischen 1982 und 1984 eindringliche Porträts von Freund:innen und Weggefährt:innen. Ein großer Teil der Aufnahmen stammt aus der Zeit vor der Ausreise der Fotografin. Es waren jene Menschen, die sie zurücklassen würde. Die Melancholie, die sich in den Bildern von „Hinter Glas“ zeigt, erfährt einen Widerhall in den Blicken der Porträtierten. Die Frage „Gehen oder Bleiben?“ trieb viele aus dem Umfeld von Barbara Metselaar Berthold um. Selbst die Fotografien aus ihrem Werk, die ausgelassen feiernde junge Menschen zeigen und Sinnbilder einer nach Freiheit und Selbstbestimmung suchenden Szene sind, entstanden nicht selten auf Abschiedspartys für diejenigen, die gehen wollten und mussten. In diesem Sinne waren sie Vorboten dessen, was Barbara Metselaar Berthold selbst erfahren würde.
Weitere Ausstellungskategorien
Kultur